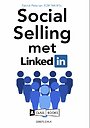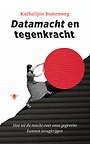1 Business Networking — Chancen und Herausforderungen.- 1.1 Netzwerkunternehmen im Informationszeitalter: Vision.- 1.1.1 Business Networking und die ‚New Economy‘.- 1.1.2 Fünf Stufen zum Business Networking.- 1.2 Vernetzung des Unternehmens: Transformation.- 1.2.1 Von der Strategie zum realen Geschäft.- 1.2.2 Schaffung der Netzwerkfähigkeit.- 1.2.3 Teil 1: Grundlagen.- 1.2.4 Teil 2: Geschäftskonzepte.- 1.2.5 Teil 3: Applikationskonzepte.- 1.2.6 Teil 4: Integrationskonzepte.- 1.2.7 Teil 5: Kritische Erfolgsfaktoren.- 1.3 Forschungsansatz.- 1.3.1 Anwendungsbezug.- 1.3.2 Business Networking Kompetenzzentren.- 1: Grundlagen.- 2 Geschäftsmodell des Informationszeitalters.- 2.1 Auslöser und Veränderungen.- 2.2 Beispiele für die neue Wirtschafts Struktur.- 2.3 Bausteine der digitalen Wirtschaft.- 2.3.1 Der Kundenprozeß.- 2.3.2 Kundenprozeßportal.- 2.3.3 Geschäftsnetzwerk.- 2.3.4 Business Collaboration Infrastructure.- 2.3.5 eServices.- 2.4 Zusammenfassung.- 3 Das Netzwerkunternehmen.- 3.1 Einleitung.- 3.2 Fallbeispiele betrieblicher Vernetzung.- 3.2.1 Supply Chain- und Relationship Management bei Dell, Amazon.com und Avnet Marshall.- 3.2.2 Relationship Management bei SAP.- 3.2.3 eProcurement bei MarketSite.net.- 3.2.4 eProcurement bei der UBS.- 3.2.5 Innovation bei der Migros-Gemeinschaft.- 3.2.6 Beschaffung, Finanzen, Immobilien und Steuern bei CommTech.- 3.3 Vernetzte Prozesse.- 3.3.1 Netzwerke als Kooperationsprozesse.- 3.3.2 Abhängigkeiten zwischen den Kooperationsprozessen.- 3.4 Modell eines Netzwerkunternehmens.- 3.5 Zusammenfassung und Ausblick.- 4 Netzwerkfähigkeit von Unternehmen.- 4.1 Netzwerkfähigkeit als Wettbewerbsfaktor.- 4.1.1 Begriff und Gestaltungsobjekte der Netzwerkfähigkeit.- 4.1.2 Netzwerkfähigkeit am Beispiel der Logistikbranche.- 4.1.3 Ansätze zur Messung von Netzwerkfähigkeit.- 4.2 Folgen für das Management: Gestaltung der Netzwerkfähigkeit.- 4.3 Zusammenfassung und Ausblick.- 2: Geschäftskonzepte.- 5 Strategien zum Business Networking.- 5.1 Einführung.- 5.1.1 Strategische Relevanz des Business Networking.- 5.1.2 Strategische Optionen im Business Networking.- 5.2 Kooperationsstrategien.- 5.2.1 Outsourcing — Auslagerung von Nicht- Kernkompetenzen (stabiles Netzwerk).- 5.2.2 Insourcing — Ausbau der bestehenden Kompetenzen (internes Netzwerk).- 5.2.3 Virtuelle Organisation — Neue Geschäftsfelder mit Kooperationspartnern (dynamisches Netzwerk).- 5.2.4 Kombinationen.- 5.2.5 Zusammenfassung der Kooperationsstrategien.- 5.3 Kooperationsprozesse.- 5.3.1 Electronic Commerce — die Transaktionsperspektive.- 5.3.2 Supply Chain Management — die Flußperspektive.- 5.3.3 Customer Relationship Management — die Beziehungsperspektive.- 5.3.4 Zusammenfassung der Kooperationsprozesse.- 5.4 Kooperationssysteme.- 5.4.1 Interne Business Networking-Systeme.- 5.4.2 Portale.- 5.4.3 Elektronische Marktplätze.- 5.4.4 Elektronische Services.- 5.5 Zusammenfassung und Ausblick.- 6 Electronic Commerce und Supply Chain Management bei der Swatch Group.- 6.1 Einführung.- 6.2 Zusammenhang von EC und SCM.- 6.3 Fallstudie: EC und SCM bei der ETA SA.- 6.3.1 Unternehmen ETA SA und Ausgangssituation.- 6.3.2 Distribution von Uhrenersatzteilen beim ETA-CS.- 6.3.3 Schritt 1: Stammdaten und interne Supply Chain.- 6.3.4 Schritt 2: Einführung der EC-Lösung.- 6.3.5 Schritt 3: Konzeption Direct Delivery Channel.- 6.3.6 Schritt 4: Kopplung an das ERP-System.- 6.3.7 Schritt 5: Weiterentwicklung der Business Networking Lösung.- 6.4 Nutzen und Erkenntnisse aus der Fall Studie.- 6.4.1 Nutzen des Business Networking bei ETA SA.- 6.4.2 Erkenntnisse bei der Einführung der Lösung.- 6.5 Zusammenfassung und Ausblick.- 7 Supply Chain Management und Electronic Commerce bei Bayer.- 7.1 Optimierung der Supply Chain direkter Güter.- 7.2 Ansätze zur verbesserten Planung.- 7.2.1 Einsatz von MRP I und MRP II Systemen.- 7.2.2 Einsatz von APS-Systemen — IS-Ansatz.- 7.2.3 Ausweitung der Supply Chain versus Scope-Ansatz.- 7.3 Supply Chain Optimierung bei der Bayer AG.- 7.3.1 Ziele der Supply Chain Optimierung.- 7.3.2 Planungsprozesse zwischen Bayer KU und Scintilla.- 7.3.3 Anforderungen seitens Bayer und Scintilla.- 7.3.4 Ableitung von Kooperationsszenarien.- 7.3.5 Unterstützte Aufgaben in den Kooperationsprozessen.- 7.3.6 Bewertung der Kooperationsprozesse.- 7.4 Informations technische Umsetzung.- 7.4.1 Anforderungen an die IT-Unterstützung.- 7.4.2 Alternativen bei der IT-Umsetzung.- 7.4.3 Entwicklung eines Collaborative Portal.- 7.5 Zusammenfassung und Ausblick.- 8 Customer Relationship Management in der Pharmaindustrie.- 8.1 Transformation der Pharmaindustrie.- 8.2 Customer Relationship Management in der Pharmaindustrie.- 8.2.1 Herausforderungen für Pharmaunternehmen.- 8.2.2 CRM bei Pharmaunternehmen.- 8.2.3 Kundenprozesse von Krankenhausapotheken.- 8.2.4 Kundenprozesse von Großhändlern.- 8.3 Healthcare-Portale.- 8.3.1 Prozeßportale.- 8.3.2 Prozeßportale im Gesundheitsbereich.- 8.3.3 Services von Healthcare Portalen traditioneller Marktteilnehmer.- 8.3.4 Services von Healthcare Portalen neuer Intermediäre.- 8.4 Kundenprozeßunterstützung von Portalen.- 8.4.1 Portale von Pharmaunternehmen versus Kundenprozeß.- 8.4.2 Portale von Intermediären versus Kundenprozeß.- 8.5 Zusammenfassung und Ausblick.- 3: Applikationskonzepte.- 9 Entwurf einer Applikationsarchitektur für die Pharmaindustrie.- 9.1 Einleitung.- 9.1.1 Problemstellung.- 9.1.2 Entstehung betrieblicher Applikationsarchitekturen.- 9.1.3 Nutzen einer Applikationsarchitektur.- 9.2 Prozeßmodell des Informationszeitalters.- 9.2.1 Trends in der Managementliteratur.- 9.2.2 Trends in der Pharmaindustrie.- 9.2.3 PROMIZ-Referenzmodell für die Pharma AG.- 9.3 Applikationsarchitekturen im Informationszeitalter.- 9.3.1 Anforderungen an die Architekturkomponenten.- 9.3.2 Komponenten der zukünftigen Applikationsarchitektur.- 9.4 Zusammenfassung und Ausblick.- 10 Systeme für das Supply Chain Management.- 10.1 Einleitung.- 10.2 Überblick Supply Chain Management.- 10.2.1 Dimensionen des Supply Chain Management.- 10.2.2 Ziele und Nutzen des Supply Chain Management.- 10.3 Supply Chain Management-Werkzeuge.- 10.3.1 Supply Chain Management-Werkzeuge im Überblick.- 10.3.2 Supply Chain Planning-Systeme.- 10.3.3 Material Requirements Planning (MRP I).- 10.3.4 Manufacturing Resource Planning (MRP II).- 10.3.5 Advanced Planning-Systeme.- 10.3.6 Module von Advanced Planning-Systemen.- 10.3.7 Hersteller von Advanced Planning-Systemen.- 10.4 Zusammenfassung und Ausblick.- 11 eProcurement: Systeme und Erfolgsfaktoren.- 11.1 Herausforderungen in der indirekten Beschaffung.- 11.1.1 Einleitung.- 11.1.2 Heutige Beschaffungsszenarien.- 11.1.3 Relevanz des eProcurement.- 11.2 Systemkomponenten und Funktionalität von eProcurement- Systemen.- 11.2.1 Katalog-und Sourcing-Dienste.- 11.2.2 Bestellanforderung und Bestellung.- 11.2.3 Lieferung und Empfang.- 11.2.4 Bezahlung und Verbuchung.- 11.2.5 Prozeßführung.- 11.3 Benchmarking-Studie eProcurement.- 11.3.1 Benchmarking Methode.- 11.3.2 Meßkriterien.- 11.4 Ergebnisse des Benchmarking.- 11.4.1 Einführung.- 11.4.2 Materialgruppen/ Content Management.- 11.4.3 Katalog-Management.- 11.4.4 Organisation.- 11.4.5 Beschaffungsprozesse und Systemarchitektur.- 11.4.6 Wirtschaftlichkeit.- 11.5 Zusammenfassung und Ausblick.- 12 Connected Smart Appliances.- 12.1 Vision.- 12.2 Fallbeispiele.- 12.2.1 Safeway.- 12.2.2 U.S. Postal Service.- 12.2.3 Siemens HomeAssistant.- 12.3 Einsatzbereiche von CSAs.- 12.4 Technologien von CSAs.- 12.5 Treiber der CSAs.- 12.6 Betriebswirtschaftliche Effekte von CSAs.- 12.6.1 Neue Prozesse.- 12.6.2 Management von komplexen Systemen.- 12.7 Zusammenfassung und Ausblick.- 4: Integrationskonzepte.- 13 Templates: Standardisierung beim Business Networking.- 13.1 Einführung.- 13.2 Definition und Ansätze zur Standardisierung.- 13.2.1 Definition und Dimensionen der Standardisierung.- 13.2.2 Voraussetzungen der Interprozeß-Integration.- 13.2.3 Ansätze zur Schließung der ‚Organisationslücke‘.- 13.3 Entwicklung eines Template-Handbuchs.- 13.3.1 Idee eines Template-Handbuchs.- 13.3.2 Komponenten eines Template-Handbuchs.- 13.3.3 Entwicklung des Template-Handbuchs bei Bosch.- 13.3.4 Übersicht und Erfahrungen.- 13.3.5 Beispieldokumente.- 13.3.6 Aktivitäten bei Template-Gestaltung und -Roll-out.- 13.4 Nutzen von Templates bei einem Pharmaunternehmen.- 13.5 Zusammenfassung und Ausblick.- 14 Enterprise Application Integration bei Robert Bosch.- 14.1 Einleitung.- 14.2 Integrationsansätze.- 14.3 Enterprise Application Integration.- 14.3.1 Überblick zur Enterprise Application Integration.- 14.3.2 Integrationsdienste.- 14.3.3 Schnittstellendienste.- 14.3.4 Transformationsdienste.- 14.3.5 Prozeßmanagementdienste.- 14.3.6 Laufzeitdienste.- 14.3.7 Entwicklungsdienste.- 14.4 Systeme zur Enterprise Application Integration.- 14.4.1 eLink von BEA Systems.- 14.4.2 United Applications Architecture von CrossWorlds.- 14.4.3 eBusiness Broker Suite von Mercator Software.- 14.4.4 Enterprise Integration Template von Level 8 Systems.- 14.5 Enterprise Application Integration bei der Robert Bosch GmbH.- 14.5.1 Ziele und Bereiche der Integration bei Bosch.- 14.5.2 Integration von ERP-Systemen.- 14.5.3 Integration von EC-Systemen.- 14.5.4 Integration von SCM-Systemen.- 14.5.5 Implementierung des Business Bus.- 14.5.6 Nutzen des EAI-Einsatzes.- 14.6 Zusammenfassung und Ausblick.- 15 eServices zur ERP-Integration von eMarkets.- 15.1 Business Networking und ERP-Integration.- 15.2 eMarkets und eServices im Business Networking.- 15.2.1 Entwicklung und Marktpotential.- 15.2.2 Nutzen von eMarkets.- 15.2.3 Nutzen der Prozeßintegration.- 15.2.4 Integrationsanforderungen.- 15.3 eServices zur Integration — der Fall Triaton.- 15.3.1 newtron und Triaton — eMarket und Systemhaus.- 15.3.2 Überlegungen zum Potential von eMarket-Integration.- 15.3.3 Triaton eService ‚A2A e-Link for eMarkets‘.- 15.3.4 Kooperation von newtron und Triaton.- 15.3.5 Geschäftsprozeßunterstützung und Nutzen.- 15.4 Umsetzung und Architektur des ‚A2A e-Link for eMarkets‘.- 15.5 Zusammenfassung und Ausblick.- 5: Kritische Erfolgsfaktoren.- 16 Kritische Erfolgsfaktoren des Business Networking.- 16.1 Herausforderungen im Business Networking.- 16.2 Charakterisierung von Business Networking-Systemen.- 16.2.1 Ausprägungen von Business Networking-Systemen.- 16.2.2 Elementarziele der Vernetzung.- 16.2.3 Fallbeispiele CommTech, ETA und Riverwood.- 16.3 Kritische Erfolgsfaktoren für Business Networking-Systeme.- 16.3.1 Kritische Masse als übergeordneter Erfolgsfaktor.- 16.3.2 Erfolgsfaktor 1: Vernetzungsprojekte sind Geschäftsprojekte.- 16.3.3 Erfolgsfaktor 2: Standards als ‚Conditio Sine Qua Non‘.- 16.3.4 Erfolgsfaktor 3: Partnerprofile.- 16.3.5 Erfolgsfaktor 4: Wechselseitiger Nutzen.- 16.3.6 Erfolgsfaktor 5: Schnelle Ausbreitung und Systemintegration.- 16.3.7 Erfolgsfaktor 6: Menschen initiieren Netzwerke.- 16.4 Zusammenfassung und Ausblick.- 17 Entwicklung einer Business Networking-Methode.- 17.1 Herausforderungen bei Business Networking-Projekten.- 17.1.1 Relevanz einer Methode für das Business Networking.- 17.1.2 Bisherige Ansätze und Anforderungen.- 17.1.3 Vorteile eines Engineering-Ansatzes.- 17.1.4 Schwerpunkt und Vorgehen der Methode.- 17.2 Projekt I: eProcurement bei der Deutschen Telekom.- 17.2.1 Geschäftsumfeld der Deutschen Telekom AG.- 17.2.2 Möglichkeiten zur Organisation der Beschaffung.- 17.2.3 Vorgehen bei der Deutschen Telekom.- 17.3 Projekt II: Supply Chain Management bei Riverwood International.- 17.3.1 Geschäftsumfeld von Riverwood International.- 17.3.2 Supply Chain-Szenario bei Riverwood International.- 17.3.3 Vorgehen bei Riverwood International.- 17.4 Erarbeitung der Business Networking-Methode.- 17.4.1 Kooperationsrelevante Dimensionen der Methode.- 17.4.2 Elemente der Business Networking-Methode.- 17.4.3 Metamodell.- 17.4.4 Vorgehensmodell und Techniken.- 17.4.5 Rollenmodell.- 17.5 Zusammenfassung und Ausblick.- 18 Anwendung der Business Networking-Methode am Beispiel SAP.- 18.1 Abgrenzung von Business Networking-Strategien.- 18.1.1 Überblick.- 18.1.2 Die Interaktion der Strategien aus Kundenperspektive.- 18.2 Eine Methode für die Implementierung von Supply Chain- Modulen.- 18.2.1 Ziele der Methode.- 18.2.2 Business Networking-Systeme und Methoden der SAP.- 18.2.3 Accelerated SAP (ASAP).- 18.2.4 Strategic Blueprint in ASAP für APO.- 18.3 Referenzbeispiel für den Strategic Blueprint.- 18.4 Zusammenfassung und Ausblick.- 19 Entwicklung einer Applikationsarchitektur.- 19.1 Einleitung.- 19.1.1 Problemstellung.- 19.1.2 Nutzen der Architekturplanung.- 19.2 Geschäftsarchitektur.- 19.2.1 Organisationsprofil.- 19.2.2 Prozeßarchitektur.- 19.3 Applikationsarchitektur.- 19.3.1 Verteilungskonzepte in Standardsoftware.- 19.3.2 Integrationsbereiche auf Applikationsebene.- 19.3.3 Struktur der Applikationsarchitektur.- 19.4 Methodisches Vorgehen.- 19.4.1 Bestehende Ansätze.- 19.4.2 Defizite bestehender Methoden.- 19.4.3 Methodenvorschlag.- 19.5 Zusammenfassung und Ausblick.- 20 Business Networking — Zusammenfassung und Ausblick.- 20.1 Fazit zum Business Networking.- 20.1.1 Effizienz Steigerung und neue Geschäftsmodelle.- 20.1.2 Zielsetzungen des Business Networking.- 20.1.3 Veränderung der Business Networking-Lösungen.- 20.1.4 Modell des Business Networking.- 20.2 Nächste Schritte im Business Networking.- 20.2.1 Evolution von Prozeßportalen und eServices.- 20.2.2 Vernetzung intelligenter Geräte und Dinge.- Abkürzungsverzeichnis.- Literatur.- Autoren.